
Grußwort des Institutsleiters Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Markschies
Neue Symbole, neue Deutungen: Die Orange auf dem Sederteller
Gedanken zum Fest von Prof. Dr. Amir Engel
Rezension "als wäre es vorbei" von Katja Petrowskaja
Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. Amir Engel im Sommersemester 2025
"besser lesen als besser wissen" Rückblick und Ausblick
Projekt "Impuls der Woche"

„Alles muss raus“ war eine Schlagzeile, die regelmäßig zu lesen war, wenn Kaufhäuser und Filialen großer Ketten zum Sommer- und Winterschluss-Verkauf einluden. Ich erinnere mich, dass man das auch bei Geschäftsaufgaben und Liquidationen lesen konnte, vor allem bei Teppichgeschäften: „Alles muss raus“. Ich erinnere mich, dass insbesondere mein Vater gern in eleganten Bekleidungsgeschäften beim Schlussverkauf vorbeischaute und dann zu Hause stolz präsentierte, was er zu herabgesetzten Preisen erstanden hatte. Mein Eindruck war aber schon als Jugendlicher auch immer, dass da Sachen sehr verbilligt angeboten wurden, die zum Normalpreis niemand mehr gekauft hätte – Farben und Formen, die längst vergangene Mode waren, unpraktisches Zeug und sinnloser Luxus. Teppiche haben meine Eltern im Schlussverkauf nie erworben, da war die Angst viel zu groß, minderwertige Ware angedreht zu bekommen. Alles muss raus, weil es die Lager verstopfte und ansonsten nur auf der Mülldeponie noch einen sinnvollen Platz gefunden hätte.
Schon im biblischen Buch Exodus kann man lesen, dass zum Pessach-Fest auch das „Alles muss raus“ gehört: Aller Sauerteig muss aus dem Haus heraus (2. Mose 12,19-20): „Ihr sollt nichts Gesäuertes essen: in allen euren Wohnungen sollt ihr ungesäuertes Brot essen“. „Alles muss raus“: Traditionelle jüdische Haushalte führen daher eine letzte Suche nach Sauerteig durch, sammeln die Reste zusammen und verbrennen sie vor dem Haus oder in einem entsprechendem Feuer in der Nachbarschaft. Was bedeutet das konkret und was können wir daraus lernen?
Ich gestehe, dass ich erst einmal meine Frau gefragt habe, wie es sich mit dem Sauerteig genau verhält. Denn Brot gebacken habe ich das letzte Mal als Student und junger Dozent auf Exkursionen mit Studierenden in der Sinai-Wüste Ägyptens. Da ist der nächste Supermarkt mit einer Brot-Theke ziemlich weit weg und also wurde für die Gruppe Brot gebacken. Aber damals hat mich nur interessiert, wie das Brot im offenen Feuer gebacken wurde, der Teig war mir ziemlich egal. Und insofern habe ich bei der Vorbereitung des Grußwortes – so peinlich das ist – erstmals über Sauerteig etwas gelesen und länger nachgedacht, einen Teig, „in dem gesunde Milch- und Essigsäure-Bakterien die Oberhand gegen Fäulnis und andere Bakterien errungen haben“, wie es im Internet heißt. Sauerteig entsteht aus Mehl, Hefe, Wasser, Wärme und Zeit (bis zu sechs Tagen). Im ungesäuerten Teig fehlt die Hefe, aber er geht dafür auch schneller. Ein Volk, das es auf seiner Wüstenwanderung eilig hat, verwendet natürlich ungesäuerten Teig. Eine Gruppe Studierender, die es auf einer Exkursion eilig hat, kann auch nicht sechs Tage warten, bis der Brotteig fertig gegangen ist. Da ist die Exkursion schon wieder beendet. Nun ist mir auch klar, dass und warum wir im Sinai ungesäuerten Teig verwendet haben – es war ja gar kein Sauerteig zur Hand. Luftiger und lockerer ist solches Brot. Daran entsinne ich mich noch sehr gut.
Nicht nur in der Hebräischen Bibel, dem Ersten oder Alten Testament, ist davon die Rede, dass der alte Sauerteig zu Pessach heraus muss. Bekanntlich verwendet auch der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther im fünften Kapitel das Bild vom Sauerteig, von dem alles raus muss. Ihm geht es darum, dass die Menschen in der christlichen Gemeinde in Korinth so eilends und so gründlich als Christenmenschen zu leben beginnen, wie es ihrer Berufung entspricht, weil unchristliches Verhalten einzelner die ganze Gemeinde so durchsetzt wie die Hefe und die Bakterien den Sauerteig. Auch an dieser Stelle gilt seiner Ansicht nach: „Alles raus“ und zwar unverzüglich. Das Bild vom Sauerteig verwendet (freilich positiv) übrigens ja auch Jesus selbst in einem Gleichnis für das Reich Gottes (Matthäus und Lukas, jeweils Kapitel 13).
Eile ist manchmal geboten. Sonst schafft beispielsweise mal schnell ein zu allem entschlossener Präsident per Dekret das Erziehungs- oder Gesundheitsministerium ab und alle Beschäftigten stehen vor verschlossenen Türen. So, wie dieser Präsident nach der Parole „alles muss raus“ verfährt, sollte man umgekehrt mit ihm und seinen Leuten verfahren: Alles raus (aus der Verantwortung im demokratischen Gemeinwesen). Das Pessachfest, seine Aufforderung, eilends den Sauerteig restlos herauszuwerfen und die christliche Adaption dieses Bildes bei Paulus fordern uns dazu auf, zu fragen, was bei uns alles eilends heraus muss. Weil es längst nicht mehr brauchbar ist, eigentlich ohnehin auf den Müll gehört oder weil man sich daran nur den Magen verderben kann. Mir fallen zu Pessach 2025 allerlei Dinge ein, die heraus müssen und zwar eilig. Pessach 2025 ist aber auch die wunderbare Botschaft vom Auszug, der frei macht und neue Gemeinschaft begründet. Neue Gemeinschaft unter den Menschen, neue Gemeinschaft aber auch mit Gott. Anders formuliert: Alles, was raus muss, muss raus, damit Platz für das ist, was uns Leben und Gemeinschaft schenkt. Alles, was raus muss, muss raus, damit alles, was rein muss, rein kann. In diesem Sinne: Chag Pessach Sameach! Und fröhliche Ostern!
Namens der Mitarbeitenden des Instituts Kirche und Judentum:
Christoph Markschies

aus: Dalia Marx: Durch das Jüdische Jahr, Leipzig 2021, 208f.;
deutsche Übersetzung: Dr. Ulrike Offenberg
Der Sederteller (auch „Sederschüssel" genannt) ist zentraler Bestandteil des Seder-abends. Darauf sind verschiedene Speisen angeordnet, die den Aufbruch aus der Knechtschaft symbolisieren. Neben Ei und Knochen, die für das Pessachopfer zu Tempelzeiten stehen, befinden sich darauf Bitterkräuter (Salat, Meerrettich), Charosset (ein braunes Mus aus Äpfeln, Nüssen, Wein, Datteln und anderen Zutaten, ein Sinnbild für die in Ägypten in Sklavenarbeit zu fertigenden Lehmziegel) und Karpas (Kartoffeln, Radieschen, Petersilie oder ein anderes Gemüse, mit dem die Fragen eröffnet werden) und Salzwasser (für die vergossenen Tränen).
Für den zunehmend praktizierten Brauch einer Orange auf dem Sederteller gibt es mehr als eine Erklärung. Die bekannteste erzählt von einer Frau, die an einen bekannten Rabbiner die Frage richtete: Warum dürfen in der Synagoge Frauen nicht aus der Torah lesen?". In aller Liebenswürdigkeit antwortete der Rabbiner: „Eine Frau auf der Bimah der Synagoge wäre wie eine Orange auf der Sederschüssel", d.h. das wäre etwas ganz Unpassendes und Undenkbares. Manche deuten diesen Brauch als Protest gegen die Diskriminierung von Menschen, die sich in der LGBTQ-Community verorten, im jüdischen Leben.
So oder so: Heute pflegen viele Familien eine Orange auf den Sederteller zu legen, um ihr Engagement für Vielfalt und die Akzeptanz aller in Familie, Gemeinde und Gesellschaft auszudrücken. Auch dieser Brauch lädt zu einem Gespräch ein und ermöglicht der Tischgemeinschaft, offen die Frage zu stellen: „Was ist heute anders?" und damit die Erzählung vom Auszug aus der Knechtschaft in die Freiheit, die den gesamten Sederabend begleitet, zu motivieren.

Pessach ist wahrscheinlich das wichtigste Fest im jüdischen Kalender. Die Ereignisse, an die es erinnert, sind dramatisch, und die Moral verwirrend, ja sogar widersprüchlich.
Die Geschehnisse, auf die Bezug genommen wird, konzentrieren sich auf die Flucht Israels aus der Knechtschaft in Ägypten. Es geht um die Figur des Mose, der zum Führer des Volkes wird, um das wundersame Eingreifen Gottes in menschliche Angelegenheiten, einschließlich der Plagen und des schrecklichen Todes der Erstgeborenen, um die Flucht Israels mitten in der Nacht, die Verfolgung durch die Ägypter und die Durchquerung des Roten Meeres. Die Offenbarung Gottes am Sinai und die Übergabe der Gebote sind zwar nicht ganz Teil der Pessachgeschichte, werden aber dennoch deutlich vorhergesagt. Die gesamte Abfolge der Ereignisse und jeder Teil davon wurde zu einem wesentlichen Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses, vor allem im Westen.
Die moralischen Werte des Pessachfestes sind jedoch vielschichtiger als man annehmen könnte. Auf der einen Seite steht die Freiheit im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Die Haggada enthält zahlreiche Anspielungen auf die Befreiung der Israelit:innen aus der Sklaverei in Ägypten. Die Abfolge von Sklaverei, Flucht und Freiheit erklärt auch die universelle Anziehungskraft des Pessachfestes und der Ereignisse, von denen es erzählt: Die Geschichte wurde zu einem animierten Musical-Film verarbeitet („Der Prinz von Ägypten“, 1998) und fand unter anderem starken Widerhall in schwarzamerikanischen Spirituals wie "Go Down Moses" mit den Worten im Chorus: "Let my people go". Die Inspiration, die versklavte schwarze Amerikaner:innen in der Geschichte des Exodus fanden, die am Pessachfest gefeiert wird, ist tiefgreifend und offensichtlich.
Andererseits ist die Entstehung einer Nation nicht weniger zentral für die Pessachfeierlichkeiten. Und die Strenge, mit der dieser Gedanke befolgt wird, scheint auf den ersten Blick im Widerspruch zur Idee der Freiheit zu stehen:
Das zentrale Gebot des Pessachfestes besagt, gesäuertes Getreide (Chametz) zu meiden, darunter natürlich auch das Grundnahrungsmittel der westlichen Esskultur, das Brot. Das Verbot von Chametz umfasst den Verzehr, das Halten, den Besitz und sogar das Sehen von Chametz (in jüdischem Besitz). Die Bedeutung dieses Rituals wird durch die Worte Gottes im Buch Exodus unterstrichen: "Sodass man sieben Tage lang keinen Sauerteig in euren Häusern findet. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel." (Exodus 12, 19). Das Pessach-Ritual verbindet und festigt auf diese Weise die Gemeinschaft des Volkes Israel.
Pessach ist daher gleichzeitig ein Fest der Freiheit und des Nationalstolzes. Unsere Aufgabe besteht darin, beide Aspekte des Festes zu feiern und zu verhindern, dass einer den anderen überschattet.

von Ingrid Ossig
Ihr literarisches Debüt Vielleicht Esther (2014) wurde in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. 2015, kurz nach der Annexion der Krim, hat sie mit ihren Foto-Kolumnen ihr eigenes Genre geschaffen: kombinierte Zeitgeschichte, Autobiografie und Landschaftsbeschreibungen in ganz neuer Form
Zehn Jahren lang schrieb Katja Petrowskaja in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über ihr „Bild der Woche“. Die Auswahl der Bilder änderte sich schlagartig vor drei Jahren, als Russland in die Ukraine einfiel.
Mit ihren Fotokolumnen, die zwischen Februar 2022 und Herbst 2024 erschienen sind, hat sie nun absichtslos eine Chronik des Krieges geschrieben, gesammelt in dem Band, der Ende Februar bei Suhrkamp erschienen ist.
Es ist eine bewegende Suche nach Schönheit und nach der verlorenen Zeit, die in ihrer zarten Melodie verzaubern. Und es sind Bilder, die verwundern, verschrecken und einen persönlich treffen.
Erschienen am 24. Februar 2025 im Suhrkamp Verlag, 217 Seiten, 25 Euro, mehr.

Judentum zwischen Zion und Diaspora
Das Seminar untersucht die historischen, theologischen und kulturellen Dimensionen der jüdischen Identität in Bezug auf die Konzepte von Heimat und Diaspora. Die Teilnehmer werden die Entstehung des Zionismus und seine Auswirkungen auf die jüdische Selbstbestimmung diskutieren und untersuchen, wie die Gründung des Staates Israel die jüdische Existenz weltweit neu definierte. Das Seminar befasst sich auch mit den reichen Traditionen und intellektuellen Beiträgen, die aus der Diasporaerfahrung hervorgingen, und betrachtet das Gleichgewicht zwischen der spirituellen und kulturellen Bedeutung Zions und der anpassungsfähigen, pluralistischen Natur von Diasporagemeinschaften. Zu den Lektüren gehören Texte von Hermann Cohen, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Max Nordau und Theodor Herzl.
Seminar: mittwochs 10-12 Uhr in der Theologischen Fakultät (Raum 306)
Jüdischer Spiritualismus: von der mittelalterlichen Kabbala bis zum zeitgenössischen New Age
Das Seminar zeichnet die Entwicklung der mystischen und spirituellen Traditionen des Judentums nach, beginnend mit den esoterischen Lehren der Kabbala im Mittelalter. Es werden Schlüsselkonzepte wie die Sefirot, die Natur der göttlichen Emanation und mystische Interpretationen heiliger Texte untersucht. Das Seminar würde dann untersuchen, wie diese Ideen in der frühen Neuzeit durch den Chassidismus transformiert und neu interpretiert wurden, was zu zeitgenössischen spirituellen Bewegungen führte, die kabbalistische Themen mit New-Age-Praktiken vermischen. Die Teilnehmer würden die kulturellen und philosophischen Einflüsse diskutieren, die dieses spirituelle Kontinuum geprägt haben.
Seminar: mittwochs 14-16 Uhr in der Theologischen Fakultät (Raum 306)


24. April 2025, 19 Uhr
Lesung:
ADRIANA ALTARAS "Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Meine eigensinnige Tante"
Eberhard-Ossig-Stiftung, Markgrafenstraße 88, 10969 Berlin
mehr
13. Mai 2024, 19.30 Uhr
Vortrag:
HELENE BEGRICH "Der Jude Jesus"
Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1, 10783 Berlin
22. Mai 2024, 19 Uhr
Lesung:
ESTHER SLEVOGT "Auf den Brettern der Welt. Das Deutsche Theater Berlin"
Eberhard-Ossig-Stiftung, Markgrafenstraße 88, 10969 Berlin
mehr
26. Juni 2024, 19 Uhr
Lesung:
AYALA GOLDMANN "Der Schofar-Flashmob und andere schräge Töne - Auserwählte Glossen aus der jüdischen Welt"
Eberhard-Ossig-Stiftung, Markgrafenstraße 88, 10969 Berlin
mehr
24. Juli 2024, 19 Uhr
Lesung:
DMITRIJ KAPITELMAN "Russische Spezialitäten"
Eberhard-Ossig-Stiftung, Markgrafenstraße 88, 10969 Berlin
mehr
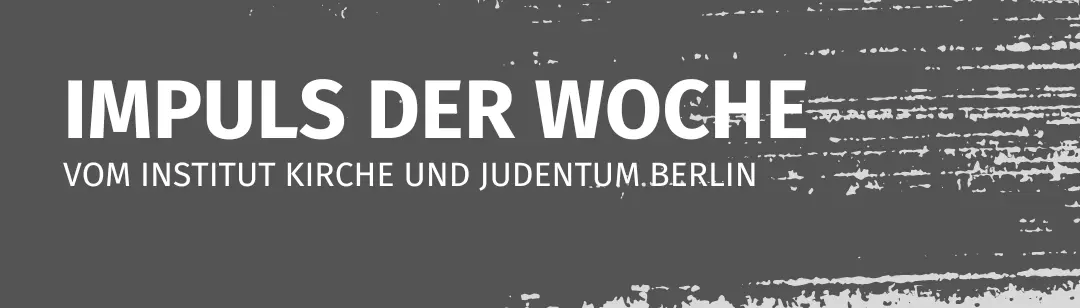
Im neuen Jahr haben Sie weiterhin die Möglichkeit, einen wöchentlichen Impuls per
E-Mail oder über die Social-Media-Kanäle des Instituts zu erhalten. Dies wird nicht mehr wie bisher ein Kommentar zum Wochenspruch sein, sondern als „Impuls der Woche“ verschiedene Themen abdecken. Im Wechsel erreichen Sie hier geistliche Impulse, wissenswerte Informationen aus dem jüdisch-christlichen Dialog, Empfehlungen unterschiedlicher Art oder Kurzinterviews mit einschlägigen Personen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch im neuen Jahr verbunden bleiben und unseren „Impuls der Woche“ vielleicht sogar empfehlen oder sich hier selbst neu anmelden.
Die Kommentare zum Wochenspruch der letzten 2,5 Jahre finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage.
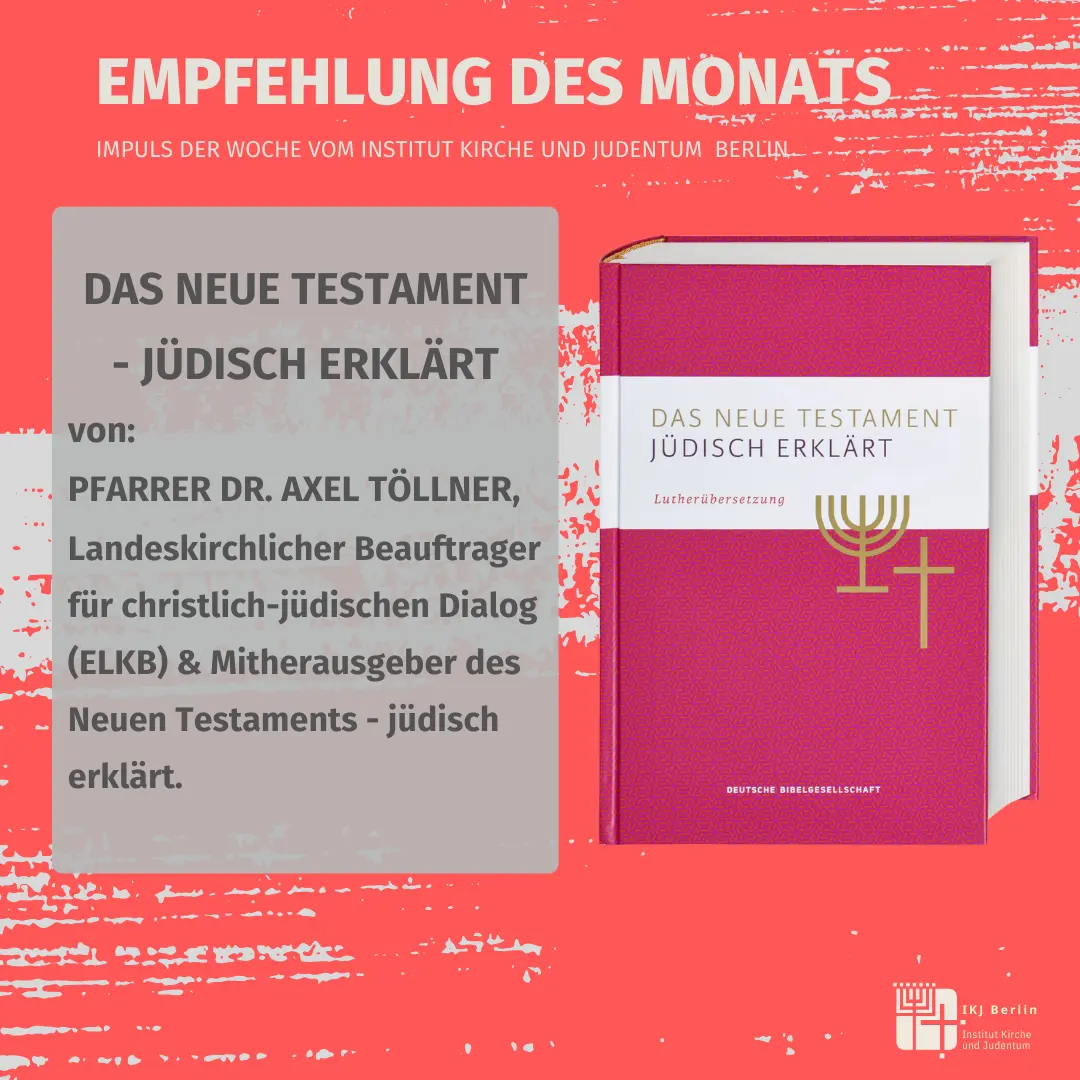
Das Neue Testament ist ein christliches Buch. Seine Frohe Botschaft ist zentral für den christlichen Glauben. Seine einzelnen Schriften sind jedoch erst einmal jüdische Quellen. Christliches ist untrennbar mit Jüdischem verknüpft. Zugleich verbinden Jüdinnen und Juden traumatische Erfahrungen damit, wie Christenmenschen ihren Glauben gelebt und weitergegeben haben.
All das zeigt das Jewish Annotated New Testament, das seit 2021 als „Das Neue Testament – jüdisch erklärt“ auch auf deutsch vorliegt. Jüdische Forscherinnen und Forscher kommentieren darin die neutestamentlichen Schriften. Sie beleuchten die Umstände, in denen sie entstanden sind, und sie zeigen, welche Wirkungen sie auf die jüdisch-christlichen Beziehungen hatten.
Amy-Jill Levine und Marc Zvi Brettler haben es angeregt und herausgegeben. Sie sehen ihr Werk als Hilfe dazu, dass jüdische Leserinnen und Leser ihre Vorbehalte überwinden und christliche Leserinnen und Leser „ihre“ Bibel besser verstehen können. Sie möchten mit ihrem Engagement „zu einem besseren Verständnis der Vergangenheit und zu einer besseren Theologie für die Zukunft“ beitragen. Denn wenn christliche und jüdische Menschen zusammenarbeiten, verwirklichen sie ein zentrales Ziel beider Gemeinschaften: „dass Hass in Liebe verwandelt werden kann“.
Wir kommen gern zu Ihnen und bieten unter anderem Folgendes an:
Sprechen Sie uns an: info@